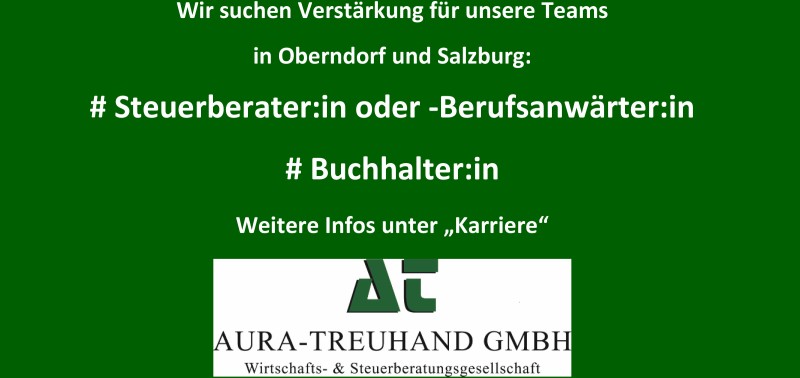Steuervorteile beim Anteilskauf lukrieren
Der Kauf von Gesellschaftsanteilen an einer Kapitalgesellschaft hat den Nachteil, dass die Anschaffungskosten nicht im Rahmen einer Abschreibung gewinnmindernd geltend gemacht werden können. Die Gruppenbesteuerung kann aber helfend einsetzen.
Der Kauf von Gesellschaftsanteilen an einer Kapitalgesellschaft hat im Vergleich zum Unternehmenskauf (= Einzelner Erwerb sämtlicher Wirtschaftsgüter und Verbindlichkeiten des Unternehmens) den großen steuerlichen Nachteil, dass die Anschaffungskosten nicht laufend im Rahmen einer Abschreibung steuerlich gewinnmindernd geltend gemacht werden können. Dieser steuerliche Nachteil kann jedoch im Rahmen der Gruppenbesteuerung insofern eingeschränkt werden, als der in der Beteiligung enthaltene Firmenwert über 15 Jahre steuerlich gewinnmindernd verwertet werden kann.
Beteiligungshöhe von mehr als 50%
Voraussetzung für die steuerliche Verwertbarkeit des in der Beteiligung enthaltenen Firmenwerts ist, dass eine Beteiligungshöhe von mehr als 50% erworben werden muss, damit die Kapitalgesellschaft in eine Gruppe integriert werden kann. Weiters ist zu beachten, dass die Beteiligung nicht von einem konzernzugehörigen Unternehmen gekauft wird und die Gesellschaft einen aktiven Betrieb hat. Für die Ermittlung der Höhe des Firmenwerts sind die steuerlich maßgebenden Anschaffungskosten der Beteiligung um das anteilige (entsprechend der erworbenen Beteiligungshöhe) unternehmensrechtliche Eigenkapital und die anteiligen stillen Reserven im nicht abnutzbaren Anlagevermögen (im Wesentlichen Grund und Boden, Kapitalbeteiligungen) zu vermindern. Maximal dürfen nur 50% der Anschaffungskosten als Firmenwert angesetzt werden. Diese 50%-Grenze gilt auch im Falle eines negativen Firmenwertes, der im Gegensatz zum positiven Firmenwert zu steuerlichen Erträgen führt. Ein negativer Firmenwert entsteht, wenn das anteilige unternehmensrechtliche Eigenkapital und die anteiligen stillen Reserven im nicht abnutzbaren Anlagevermögen höher sind als die Anschaffungskosten.
Weitere Artikel aus Ausgabe 09/2013
Wann muss Stiftungsurkunde dem Finanzamt offengelegt werden?
In einem Erkenntnis hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden, dass die Vorlage der Stiftungsurkunden bis zur Rechtskraft des Körperschaftsteuerbescheides des jeweiligen Jahres erfolgen muss. Dann können die begünstigenden Regelungen für die Besteuerung von Privatstiftungen zur Anwendung kommen.
Hohe Strafen bei nicht ordnungsgemäßer Entlohnung von Dienstnehmern
Werden Mitarbeiter unter dem kollektivvertraglichen Mindestlohn entlohnt, droht dem Dienstgeber nicht nur ein kostenintensives Verfahren vor dem Arbeitsgericht, sondern auch eine hohe Verwaltungsstrafe.
EuGH entscheidet über Vorsteuerabzug bei Photovoltaikanlagen
Errichter von Photovoltaikanlagen können ab nun die Vorsteuer für die Errichtung der Photovoltaikanlage abziehen und müssen auf ihren Stromrechnungen 20% Umsatzsteuer ausweisen. Das folgt aus einem Urteil der Europäischen Gerichtshofes (EuGH).
Neuerungen bei der Pauschalierung in der Land- und Forstwirtschaft ab 1.1.2014
Die steuerliche Gewinnermittlung der Land- und Forstwirtschaft wird durch die Neuerungen der Pauschalierungsverordnung ab 1.1.2014 viele Änderungen mit sich bringen. Mit Stichtag 1.1.2014 werden die Einheitswerte neu festgestellt, wodurch die neue Pauschalierungsverordnung ab dem Jahr 2015 erstmals zur Anwendung kommt.
Neu ab 1.1.2014: Das Bundesfinanzgericht
Mit 1.1.2014 tritt an die Stelle des Unabhängigen Finanzsenats ein neu geschaffenes Verwaltungsgericht des Bundes, das Bundesfinanzgericht. Damit wird das Abgabeverfahren wesentlich geändert.